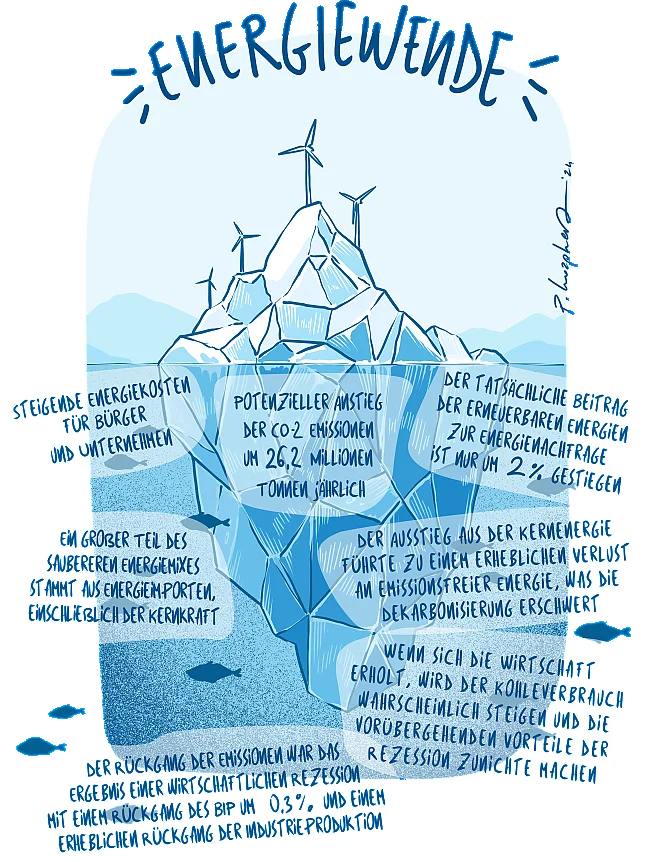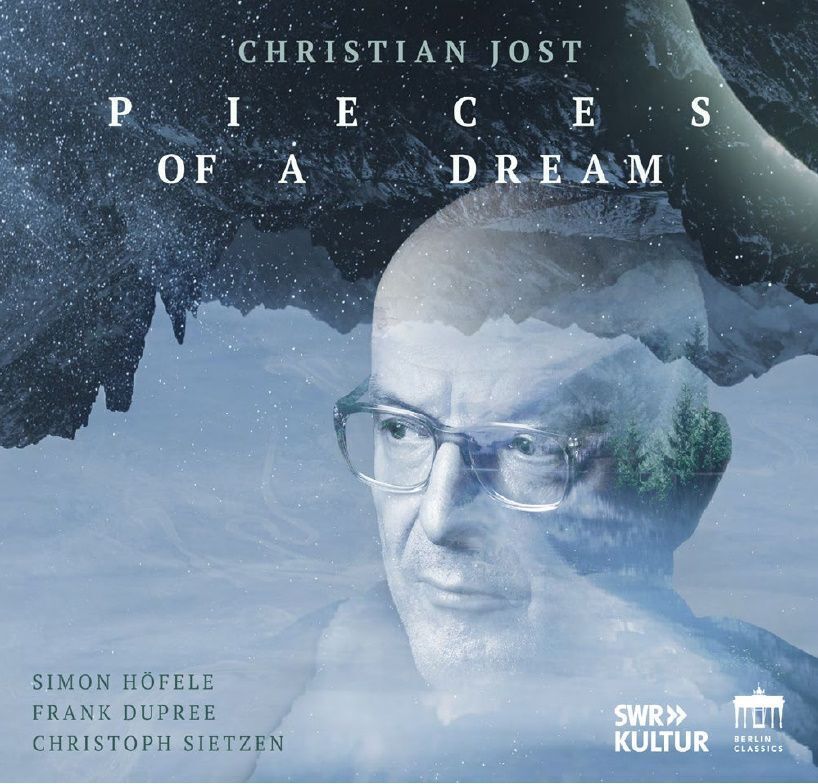Nach der aufgehobenen deutschen Teilung und der Wahl Berlins zur Hauptstadt wird emsig darüber nachgedacht, ob nicht das föderale System über die Sicherung der jeweiligen Landesinteressen hinaus notwendig gewordene Strukturveränderungen verhindere. Anlässlich der Weigerung Sachsen-Anhalts, dem Medienänderungsstaatsvertrag zuzustimmen, haben die letzten Urteile aus Karlsruhe die Verantwortung für die Zukunft angemahnt. Jutta Roitsch macht auf die Bedeutung dieser Urteile aufmerksam.
Der „gesellschaftliche Zusammenhalt“ wird landauf, landab beschworen: Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in millionenschweren Forschungsprojekten, von Wahlkämpfern von Links bis Rechts, in den so genannten sozialen Medien und nicht zuletzt vom Bundespräsidenten. Die beiden Wörter signalisieren, dass etwas in Deutschland zu verkümmern droht oder bereits verkümmert ist. Gemeint ist das Denken und Handeln nicht nur für sich selbst, sondern für und mit den Anderen. Dafür gibt es das schöne Wort Gemeinwohl, das Fundament für eine lebendige Demokratie. In zwei Urteilen innerhalb von fünf Monaten haben die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe die bisherigen wolkigen Formeln geerdet. Es sind unerhörte Töne, die vom ersten Senat im März und im August ausgestrahlt wurden. Die Richterinnen und Richter griffen dabei zu Worten, die in der breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit noch nicht angekommen sind, aber den weiteren Debatten und Auseinandersetzungen über den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine klare Orientierung geben. Sie lauten: „Intertemporale Freiheitssicherung“ (Urteil vom März) und „föderale Verantwortungsgemeinschaft“ (Urteil vom Juli, bekanntgegeben am 5.August). Großartige Wortschöpfungen, die noch viel mehr sind.
Die Pressemitteilung von Anfang August ist relativ kurz.
Veröffentlicht wird der Beschluss vom 20. Juli (welch ein Datum für
geschichtsbeladene Menschen), in dem der 1. Senat dem Land
Sachsen-Anhalt in einer einstimmigen Entscheidung vorgeworfen hat, die
„Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus
Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes verletzt zu haben“. In der
Weigerung dieser Landesregierung, dem ersten
Medienänderungsstaatsvertrag zuzustimmen, der eine unter den 16
Bundesländern ausgehandelte eher geringe Gebührenerhöhung enthielt,
sieht der erste Senat die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Fernsehen nicht mehr gewährleistet.
Bei dieser Rüge bleibt es aber nicht. Das Gericht schlägt sich in einer
unverschnörkelten Deutlichkeit auf die Seite der Rundfunkanstalten von
ARD, ZDF und Deutsch-landradio, die gegen die
Verweigerung eines Bundeslandes geklagt hatten. „Für die
funktionsgerechte Finanzierung der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten besteht eine staatliche Gewährleistungspflicht“, heißt
es in dem Beschluss wörtlich (1 BvR 2756/20, 1 BvR 2777/20, 1 BvR
2775/20). Und daraus leiten die Richterinnen und Richter ein politisches
Handeln ab, das für den Föderalismus im Allgemeinen und den Ländern im
Besonderen, vor allem ihrem in keiner Verfassung vorgesehenen Gremium
namens Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), neue Maßstäbe setzt. Den Ländern, die
die Gesetzgebungskompetenz für die Finanzierung des Rundfunks haben,
obliege die Finanzierungspflicht „als föderale
Verantwortungsgemeinschaft, wobei jedes Land Mitverantwortungsträger
ist.“ Die Wucht und Tragweite dieser Aussage erschließt sich erst durch
einen Rückblick, der bis in die Jahre 1994 und 2002 reicht.
Es geht um die 42. Änderung des Grundgesetzes am 27. Oktober 1994 und
die daraus abgeleitete Rechtsprechung des 2. Senats des
Bundesverfassungsgerichts. Es berührt eine lange wenig beachtete
Weichenstellung: Die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes zur „Wahrung der
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes
hinaus“ (Artikel 72 Grundgesetz) wurde zu Gunsten der Länder beschnitten
und beschränkt, „wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts-und
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht“. Der bis dahin akzeptierte kooperative
Bundesstaat fand seine Grenzen.
Ein weiterer Zusatz räumte dem Bundesrat, einer Landesregierung oder einem Landesparlament das Recht ein, bei Meinungsverschiedenheiten das Bundesverfassungsgericht anzurufen (Artikel 93, Absatz 2a). Acht Jahre später machte die bayerische Staatsregierung davon erstmals Gebrauch. Worum es ging? Um einen Beruf, der in den heutigen pandemischen Zeiten beklatscht und als systemrelevant hochgelobt wurde – den Altenpfleger, die Altenpflegerin, ein nichtakademischer Ausbildungsberuf, dem die damalige rot-grüne Bundesregierung erstmals eine bundeseinheitliche Aufwertung und Struktur geben wollte. Die Bayern beharrten auf ihrer Zuständigkeit für diese Ausbildung in überwiegend privaten und öffentlichen (Krankenhaus)Schulen. Das Normenkontrollverfahren landete beim 2. Senat, der für Streitigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern zuständig ist.
Und hier fiel am 24. Oktober 2002 jenes folgenschwere Urteil,
das mit dem bisherigen kooperativen Bundesstaat, dem Bestreben von
Gleichheit und Gleichwertigkeit aufräumte.
Der Kernsatz damals lautete: „Sinn der föderalen Verfassungssystematik
ist es, den Ländern eigenständige Kompetenzräume für
partikulardifferenzierte Regelungen zu eröffnen“ (BVerfG, 2BvF1/01). Für
den Beruf der Altenpflege sahen die Richterinnen und Richter in dem
einstimmigen Beschluss zwar letztlich kein Bedürfnis für
„partikulardifferenzierte Regelungen“, weil es dem Bund schließlich um
einen zeitgerechten, modernen Ansatz und eine „Aufwertung“ gegangen sei.
Unterschiedliche Ausbildungsvoraussetzungen könnten schließlich „im
deutschen Wirtschaftsgebiet störende Grenzen aufrichten“, meinte die
Richterschaft geschlossen.
In zwei weiteren Klagen der bayerischen Staatsregierung (2004 und 2005)
gegen die Einführung von Juniorprofessuren sowie des Verbots von
Studiengebühren sah der 2. Senat dann sehr wohl störende Grenzen und
Eingriffe in die akademische Welt, die die Länder regeln. Er untersagte
dem Bund, unterschiedliche Wege zum Beruf des Hochschullehrers oder der
Hochschullehrerin gesetzlich zu eröffnen, ein Verbot von Studiengebühren
vorzugeben. Mehrheitlich sah er seine Aufgabe darin, die Position der
Länder zu stärken und sie aufzufordern, Vielfalt und Wettbewerb zu
gestalten. Zwei Richterinnen und ein Richter kritisierten in einem
bemerkenswert klaren und scharfen Minderheitsvotum die enge Auslegung
der Grundgesetzänderungen aus dem Jahr 1994 durch die Senatsmehrheit,“
die dem Bund praktisch jede Möglichkeit zu neuer politischer Gestaltung
(…) verschließt“.
Der Rückblick auf eine einschneidende Änderung des Grundgesetzes und die Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht ein Jahrzehnt später belegt die Verschiebung der gesamtstaatlichen Verantwortung zu Gunsten der Länder. Ihnen fiel und fällt es zu, über den sozialen und kulturellen Zusammenhalt der Gesellschaft zu entscheiden, Vielfalt und Differenz, Unterschiede und Ungleichheit auszubalancieren. Was ist aus dieser vom Bundesverfassungsgericht abgesegneten Machtverlagerung in den letzten fünfzehn Jahren geworden? In den pandemischen, wahlkämpferisch aufgemischten Zeiten häufen sich die Vorwürfe gegen den Föderalismus schlechthin und reichen vom Vorwurf der organisierten Verantwortungslosigkeit insbesondere der Kultusministerinnen und Kultusminister bis zum Rundumschlag gegen den kleinstaatlichen Flickenteppich.
Und in diese gereizte bis empörte Stimmung platzt das Bundesverfassungsgericht mit seinen beiden Entscheidungen zur „föderalen Verantwortungsgemeinschaft“ und „intertemporalen Freiheitssicherung“. Sie sind eine Mahnung an die Länder und den Bund, vielleicht auch an den eigenen zweiten Senat, die Sichtweise der Partikulardifferenzierung, der betonten Aufforderung zu Konkurrenz und Wettbewerb aufzugeben Bei der Klage der Rundfunkanstalten gegen das Land Sachsen-Anhalt leuchtet die Antwort aus Karlsruhe unmittelbar ein: Alle 16 Länder haben sich schließlich auf ein Verfahren zur Finanzierung geeinigt. Will ein Land aus dieser Einigung heraus, dann muss es sich mit allen anderen fünfzehn auf eine neue Struktur, ein neues Verfahren einigen. Sich nur zu verweigern, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht verantwortungslos. Ganz so unwirsch hat es der 1. Senat nicht formuliert, aber dennoch unmissverständlich erklärt: „Eine verfassungrechtlich tragfähige Rechtfertigung für das Unterlassen der Zustimmung des Landes zum Staatsvertrag (… ) besteht nicht“. Doch nicht nur diese drastische Rüge macht den Beschluss vom 20. Juli so bemerkenswert.
Die Verpflichtung auf eine Verantwortungsgemeinschaft lässt sich auch auf die Kläger ausdehnen. Der Absatz über Ziel und Zweck der grundgesetzlichen Rundfunkfreiheit dürfte in die Schulbücher und sonstigen Handbücher zur Pressefreiheit eingehen. “Die Rundfunkfreiheit dient der freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung“, heißt es zunächst eher selbstverständlich. Der Auftrag im Grundgesetz „zielt auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Ausdruck finden“. Und zwar „durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden. Dies gilt gerade in Zeiten vermehrten komplexen Informationsaufkommens einerseits und von einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake News, Deep Fakes andererseits.“ Das sind Sätze von Gewicht. An ihnen wird der heftige aktuelle Streit über die Programmpolitik der Rundfunkanstalten zu messen sein.
Wie hoch das Verfassungsgericht die Messlatte bei der zweiten Entscheidung zur „intertemporalen Freiheitssicherung“ gelegt hat, ist bislang weniger klar. In dem Urteil zum Klimaschutzgesetz vom 24. März (1 BvR 2656/18,1 BvR 78/20,1 BvR 96/20, 1BvR 288/20) dehnen die Richterinnen und Richter den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit im Artikel 2 des Grundgesetzes (Absatz 2, Satz 1) „auch“ auf eine in die Zukunft weisende Verpflichtung aus, „Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen“: Der heutige Gesetzgeber, der die Weichen für künftige Freiheitsbelastungen (so im Klimaschutz) stelle, habe die Verhältnismäßigkeit der Auswirkungen zu prüfen. Und notfalls die Weichen umzustellen, rechtzeitig. Die „intertemporale Freiheitsicherung“ erklärt der erste Senat mit einem einzigen Satz: „Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung der Freiheitschancen über die Generationen.“
In dem umfangreichen Urteil wird die richterliche Wortschöpfung
nicht weiter erläutert. Es fehlen die sonst üblichen Verweise auf die
Literatur oder die eigene, bisherige Rechtsprechung. Und so hat in den
letzten Wochen und Monaten unter Ver-fassungsrechtlern (es sind
weitgehend nur Männer) und Politikwissenschaftlern die Deutung und
Ausleuchtung begonnen.
Eine gewählte Plattform ist das Internet, genauer „verfassungsblog.de“.
Marten Breuer, Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der
Universität Konstanz, zeigt sich am 18. Mai überrascht, dass der 1.
Senat ohne Begründung eine neue Grundrechtsdimension eröffnet habe und
das angesichts der „sonst üblichen Begründungstiefe“. Er sieht darin ein
hohes Missbrauchsrisiko. Aus Grundrechten würden Grundpflichten, „indem
man beim Gebrauch der Grund-und Freiheitsrechte heute stets auch die
Auswirkungen für den künftigen Freiheitsgebrauch anderer
mitzuberücksichtigen hat“. Es beunruhige ihn die „gewisse Diffusität“
und eine mögliche „unkontrollierbare Ausweitung“, denn betroffen sei
nach dem Urteil „praktisch jegliche Freiheit“, die der Heutigen wie „die
Freiheit der Anderen“ (so nennt er seinen Text). Er erinnert an Themen
wie die Staatsverschuldung, die sozialen Sicherungssysteme mit der Rente
oder die Festlegungen innerhalb von militärischen Bündnissen.
Eine Woche später (am 25. Mai) steigt Breuers Kollege an der Freien Universität Berlin, Christian Callies, im „verfassungsblog“ in die Deutungsgeschichte ein, in „rechtsdogmatischer Hinsicht“ ebenfalls misstrauisch. Sein Vorwurf gegen die Richterschaft ist nicht neu und lautet in immer anderen Varianten: Karlsruhe mache zu viel Politik. Mit diesem Urteil zum Klimaschutzgesetz werde das Bundesverfassungsgericht zum „Hüter der Generationengerechtigkeit“, der „die vom Gesetzgeber vorgenommene ’Freiheitsverteilung’ überprüft“. Warum nicht, wenn die Politik nur in Legislaturperioden denkt und handelt? Wenn die Parteien nur die heutige Wählerschaft fest im Blick haben, Kinder und Jugendliche, die nächste und übernächste Generation keine Rolle spielen? Wer vertritt ihre Grundrechts-und Freiheitsinteressen, die in den pandemischen Zeiten schon so schmählich missachtet wurden? Der „verfassungsblog“ hat Sommerpause. Ob die Ausleuchtung des Spruchs aus Karlsruhe fortgesetzt wird und längst vorhandene wissenschaftliche Auseinandersetzungen zur Generationsgerechtigkeit zur Kenntnis genommen werden?
Die Fragen treiben auch den Demokratieforscher Wolfgang Merkel um, wenn er sich in der Online-Zeitschrift IPG äußert, die die Friedrich Ebert Stiftung herausgibt (11. Mai). Er sieht in dem Urteil einen „demokratieabträglichen Trend“, weil es an der „Doktrin der richterlichen Selbstbeschränkung“ kratze. Den Jubel der Klimaaktivisten teilt Merkel nicht: „Es mag ein guter Tag im symbolischen Kampf gegen die Erderwärmung gewesen sein, ob es auch ein guter Tag für die parlamentarische Demokratie war, wage ich zu bezweifeln,“ sagt er in dem IPG-Interview. Und er erinnert daran, dass immer mehr nicht gewählte Institutionen wie die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission oder die Ministerpräsidentenkonferenz weitreichende „intertemporale“ Entscheidungen träfen: In der Umwelt-und Klimapolitik, aber auch in der Geld- und Sozialpolitik. Er nennt diesen Trend „Expertokratisierung der Demokratie“ und an diesem Trend seien die Richterinnen und Richter in Karlsruhe beteiligt. Ein nicht sehr neuer Vorwurf oder eine demokratisch-engagierte Warnung?
Die ersten Kommentare aus der Wissenschaft fallen bisher eher kurzatmig aus, erneuern bekannte Bedenken. Doch vor allem im Rückblick auf die Änderungen des Grundgesetzes, die Streichung der einheitlichen Lebensverhältnisse, die Beschneidung des Bundes in der Gesetzgebung zu Gunsten der Länder und die bisherigen Auslegungen durch das Bundesverfassungsgericht können die beiden Urteile dieses Jahres auch als wahrhaft demokratieförderlich eingestuft werden: Als eine höchstrichterliche Mahnung zu einem neuen Gesellschaftsvertrag über die Generationen hinweg und zu einer neuen Verantwortungsgemeinschaft. Eine solche Mahnung zu hören, täte der Republik gut. Allen daran Beteiligten.
Von der „Partikulardifferenz“ zur „Verantwortungsgemeinschaft“ über die Generationen hinweg
Zur Entstehung und Hintergründen siehe auch: Jutta Roitsch, Partikulardifferenz statt Bundesstaat, in: vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, Heft 2, Juni 2005, S.117 ff